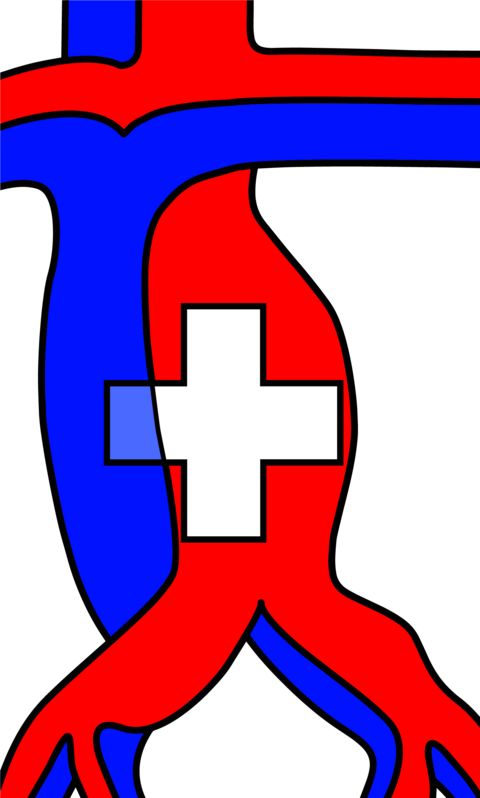Das Verhältnis zwischen Patient:innen und der Ärzteschaft bewegt sich innerhalb von höchstpersönlichen Lebensbereichen der Patient:innen und betrifft häufig besonders schützenswerte Informationen. Daher ist es geprägt von einem besonderen Vertrauensverhältnis. Zumindest sollte das so sein. In der Realität können aber immer wieder Behandlungssituationen entstehen, in denen dieses Vertrauensverhältnis eine nachhaltige Störung erfährt. Ein unerwünschtes Behandlungsresultat oder ein ausbleibender Behandlungserfolg belasten möglicherweise dieses Vertrauensverhältnis und können zum Anlass für schwerwiegende Vorwürfe gegenüber der Ärzteschaft werden. Schnell steht der Vorwurf eines "Kunstfehlers" im Raum. Stehen solche Vorwürfe dann noch im Zusammenhang mit einem Todesfall, wird die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung zur Klärung eines möglichen Fremdverschuldens eröffnen. Der folgende Artikel soll etwas Klarheit in die Abläufe und verwendeten Begrifflichkeiten rund um die Beurteilung eines Behandlungsfehlervorwurfes bringen.
Hinsichtlich der möglichen unerwünschten Behandlungsergebnisse werden die folgenden Situationen bzw. Begriffe unterschieden(1).
1. Ausbleiben des Behandlungserfolges (nicht vermeidbar)
2. Behandlungsrisiko (nicht vermeidbar)
3. Behandlungskomplikation (nicht vermeidbar)
4. Behandlungsfehler (vermeidbar)
5. Diagnoseirrtum (nicht vermeidbar)
6. Diagnosefehler (vermeidbar)
Ad Ausbleiben des Behandlungserfolgs
Der Behandlungsvertrag zwischen Patient:innen und Ärzteschaft gilt in den meisten Fällen als "einfacher Auftrag" im Sinne der Art. 394 ff. OR(2). Die Natur des Auftragsrechts liegt darin, dass es durch die Treuepflicht des Beauftragten geprägt ist. Der Beauftragte (Ärzteschaft) hat die Interessen des Auftraggebers (Patient:innen) umfassend zu wahren. Ein bestimmtes Ergebnis ist vertraglich hingegen nicht geschuldet. Für die diagnostizierende und behandelnde Ärzteschaft heisst das, dass Diagnostik und Behandlung sorgfältig im Sinne der aktuellen medizinischen Wissenschaft sein müssen und nur so weit gehen dürfen, wie es der urteilsfähige Patient oder die urteilsfähige Patientin wünscht. Dieser Patientenwille sollte wenn immer möglich auf der Basis einer umfassenden Aufklärung im Wissen um die Risiken einer Behandlung oder auch das Risiko eines Behandlungsverzichtes gebildet worden sein und ist zu akzeptieren, auch wenn er aus persönlicher oder ärztlicher Sicht nicht der richtige zu sein scheint. Auch das Medizinalberufegesetz verpflichtet die Ärzteschaft in Art. 40 lit a in diesem Sinne: "Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus; sie halten sich an die Grenzen der Kompetenzen, die sie im Rahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung erworben haben."(3)
Dass im Auftragsrecht kein Behandlungsergebnis geschuldet ist, steht nun aber ein wenig im Widerspruch zur Erwartungshaltung, mit der sich so manche Person in ärztliche Behandlung begibt. Patientinnen und Patienten neigen natürlich trotzdem dazu, die Qualität der ärztlichen Behandlung am Erfolg, also der Heilung, festzumachen. Wird der gemeinsam angestrebte Behandlungserfolg dann nicht erreicht oder steht vielleicht sogar der Tod des Patienten oder der Patientin am Ende der Behandlung, kann schnell der Vorwurf einer Fehlbehandlung ganz einfach auf der Basis entstehen, dass Patienten und Patientinnen bzw. deren Angehörige die Natur des Auftragsrechts nicht kennen und nicht wissen, dass Ärztinnen und Ärzte eben den Behandlungserfolg gar nicht schuldig sind.
Sollten derartige Fälle bis zur Strafanzeige gebracht werden oder im Falle eines meldepflichtigen Todesfalles zu einer staatsanwaltschaftlichen Untersuchung führen, ist es Aufgabe des rechtsmedizinischen und eines Fachgutachters, zu prüfen, ob die Behandlung lege artis erfolgte oder ob es Anhaltspunkte für eine medizinische Sorgfaltspflichtverletzung gibt. Muss Letzteres verneint werden, wird die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen oder allenfalls gar nicht erst an die Hand nehmen. Das Ausbleiben des Behandlungserfolges ist also solange unproblematisch, wie die Behandlung lege artis erfolgt ist und die Patient:innen nach hinreichender Aufklärung in die Behandlung eingewilligt haben.
Ad Behandlungsrisiko
Das Behandlungsrisiko geht vom Patienten bzw. der Patientin selbst aus. Dabei können vorbestehende Krankheiten, ein allfällig reduzierter Allgemeinzustand oder das fortgeschrittene Alter Risiken für indizierte Behandlungen begründen, die den Behandlungserfolg gefährden oder im schlimmsten Fall den Tod unter der Behandlung zur Folge haben können. Die ASA-Klassifikation versucht z.B. dieses Risiko präoperativ zu quantifizieren. Über diese Risiken hat die Ärzteschaft die Patient:innen umfassend und verständlich aufzuklären, damit sie das Selbstbestimmungsrecht wahrend in die Behandlung einwilligen oder sie auch ablehnen können. Es muss letztlich auch in die Behandlungsrisiken eingewilligt werden, bevor die Behandlung begonnen werden kann. Bei urteilsunfähigen Patient:innen entscheidet die Ärzteschaft gemäss dem vorgängig geäusserten oder mutmasslichen Willen der Patient:innen. Mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (ZGB, Art. 378) wird diesbezüglich aber auch den nächsten Angehörigen eine wichtige Entscheidungsfunktion zugewiesen.
Beispiel: Bei einem Patienten steht eine grosse Bauchoperation zur Entfernung eines Tumors an. Der Patient ist schwer kardial vorbelastet. Es besteht das erhöhte Risiko, dass sein Herz die Belastung des Eingriffes bzw. der Narkose möglicherweise nicht mehr bewältigen kann und während oder nach der sorgfältigen und im Sinne der Tumorentfernung erfolgreichen Operation ein erneuter Herzinfarkt oder gar ein Herzversagen mit Todesfolge auftreten könnte. Das Herzversagen hätte auch jederzeit ohne den gegenständlichen Eingriff passieren können, wurde aber durch die Belastungen rund um den Eingriff begünstigt.
Behandlungsrisiken gelten im Allgemeinen als unvermeidbar. Das entbindet die behandelnde Ärzteschaft allerdings nicht davon, über diese Risiken im Vorfeld des Eingriffes aufzuklären, angemessene Massnahmen zu ergreifen, dass diese Risiken soweit wie möglich verringert werden, sich auf die allfällige Verwirklichung dieser Risiken vorzubereiten, um sie im Falle ihrer Verwirklichung auch zeitnah erkennen und sorgfältig angehen zu können.
Ad Behandlungskomplikation
Die Behandlungskomplikation nimmt ihren Ursprung in der Behandlung selbst. Medizinische Behandlungen und darunter insbesondere chirurgische Eingriffe können trotz korrekter und sorgfältiger Durchführung auch bei gesunden Patient:innen nicht vermeidbare Nebenwirkungen oder Risiken aufweisen. In der Regel sind diese bei Behandlungsbeginn bekannt. Auch hier ist die Aufklärung der Patient:innen und deren Einwilligung zur Behandlung von zentraler Bedeutung. Eine in der konkreten Behandlungssituation mögliche, jedoch unterlassene Aufklärung wird der Ärzteschaft als Unterlassung zur Last gelegt. Bezüglich der stattgehabten Aufklärung trägt die Ärzteschaft die Beweislast, zumindest aus zivilrechtlicher Sicht. Daher empfiehlt es sich, den Inhalt der Aufklärung und auch die Einwilligung wenn immer möglich schriftlich zu dokumentieren.
Beispiel: Eine ältere, aber weitestgehend gesunde Dame erleidet im Rahmen eines Sturzes in der Häuslichkeit einen Schenkelhalsbruch. Um die Mobilität der Frau wiederherzustellen, ist eine Hüft-TEP indiziert. Im Rahmen der Operation entwickelt sich eine tödliche Fett- und Knochenmarksembolie ausgehend von der Einbringung des Marknagels. Ohne den Eingriff wäre es sicher nicht zur tödlichen Fettembolie gekommen.
Behandlungskomplikationen gelten im Allgemeinen als unvermeidbar. Aber auch hier gilt, dass alles Mögliche getan worden sein muss, um das Risiko des Auftretens der Komplikation zu minimieren, auf das Auftreten vorbereitet zu sein und im Falle des Auftretens die Komplikation auch lege artis erkennen und behandeln zu können.
Ad Behandlungsfehler
Die ärztliche Behandlung der Patient:innen muss sich an den zum Zeitpunkt der Behandlung allgemein anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft ausrichten. Diese Regeln liegen für viele Erkrankungen bzw. Verletzungen in Form von Guidelines vor, welche innerhalb der spezifischen Fachgesellschaften erarbeitet wurden. Solange also die Behandlung Guideline-konform durchgeführt wurde, darf am Ende der Behandlung auch der Heilungserfolg ausbleiben, sich ein Risiko verwirklichen oder eine Komplikation eintreten. Auch der Tod darf am Ende einer sorgfältigen Behandlung stehen, soweit darüber aufgeklärt wurde. Erst wenn der Schaden oder der Tod der Patient:innen auf eine nicht sorgfältige Behandlung zurückzuführen ist, spricht man von einem Behandlungsfehler. Behandlungsfehler werden nur angenommen, wenn die Behandlung im Sinne des Auftragsrechts als nicht sorgfältig beurteilt werden muss. Nicht das Outcome bestimmt also, ob eine Behandlung fehlerhaft war, sondern die Behandlung selbst darf sich nicht ausserhalb der aktuell gültigen Behandlungs-Guidelines bzw. des darin befindlichen ärztlichen Ermessensspielraums bewegt haben. Vor über 100 Jahren sprach bereits der bekannte Pathologe Virchow von «Mangel an gehöriger Aufmerksamkeit oder Vorsicht». Früher sprach man auch von «ärztlicher Kunst», was zu dem Begriff «Kunstfehler» führte, welchen man heute aber vermeiden sollte.
Im Falle eines vorgeworfenen Behandlungsfehlers müssen Gutachten dann vor allem zwei Fragen klären. Erstens gilt es im Sinne o.g. Ausführungen zu beurteilen, ob die Behandlung zu ihrem Zeitpunkt als sorgfältig zu beurteilen ist. Wenn man dabei zum Schluss kommt, dass tatsächlich ein Behandlungsfehler vorliegt, ist für die juristische Beurteilung ebenfalls zu prüfen, ob dieser Fehler dann auch kausal für den Schaden bzw. den Tod war. Damit es zu einer Anklage und Verurteilung kommen kann, muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Fehler und dem Schaden nachgewiesen werden. Im Sinne einer conditio sine qua non muss also geklärt werden, ob der Schaden bzw. der Tod nicht auch ohne den Fehler eingetreten wäre bzw. dass der Schaden bzw. der Tod klar auf den Fehler zurückgeführt werden kann. In der Rechtsmedizin werden solche Gutachten heute immer unter Beizug eines ärztlichen Fachvertreters erstellt, der im konkret zu beurteilenden Sachverhalt auch über die nötige praktische Erfahrung und Expertise verfügt. Wird ein Fehler gutachterlich bestätigt, wird das Gericht eine Verletzung der objektiven Sorgfaltspflicht, d.h. einen Verstoss gegen die Regeln der medizinischen Wissenschaft und Praxis, rügen.
Beispiel: Während der OP-Vorbereitung wurde ein Schlauch versehentlich verkehrt herum in die Herz-Lungen-Maschine eingelegt, sodass während der Operation am offenen Thorax nicht Blut aus dem Körper angesaugt, sondern Luft in den Kreislauf der Patient:in gepumpt wurde. Die Patient:in verstarb an den Folgen der zentralen Luftembolie.
Behandlungsfehler können durch Tun oder Unterlassung begangen werden und sind per definitionem vermeidbar.
Ad Diagnoseirrtum
"Irren ist menschlich" und damit auch ärztlich. Auch Ärztinnen und Ärzte dürfen sich irren. Die Ärzteschaft garantiert im Auftragsrecht auch nicht für eine korrekte Diagnosestellung, jedoch für eine korrekte, sorgfältige Untersuchung und Abklärung der Patient*in. Es ist möglich, dass die Ärzteschaft trotz einer sorgfältigen Diagnostik einem diagnostischen Irrtum unterliegt, den eine spätere Begutachtung (ex post) als solchen erkennt und bezogen auf die konkrete Situation (ex ante) als nachvollziehbar einschätzt. Eine ganze Reihe therapeutischer Ansätze schliesst den Diagnoseirrtum sogar implizit mit ein. Manchmal ist die bereits eingeleitete Therapie Teil der Diagnosestellung und man kommt erst unter Berücksichtigung der Wirkung der eingeleiteten Therapie zur richtigen Diagnose. Man denke z.B. an die Gabe eines unspezifischen Antibiotikums solange die Resultate der Mikrobiologie noch nicht zur Verfügung stehen. Der nachvollziehbare Diagnoseirrtum ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Diagnose in der rückwirkenden ex-post Betrachtung zwar als falsch erwiesen hat, die Diagnosestellung aus der Sicht ex ante aber sorgfältig erfolgte und die Mehrheit aller anderen Ärztinnen und Ärzte unter den gleichen Umständen dem gleichen Irrtum unterliegen würden. Obwohl Diagnoseirrtümer im Medizinalalltag weit verbreitet sind, hat der Begriff des Diagnoseirrtums in der Rechtsprechung noch nicht so recht Fuss gefasst.
Beispiel: Eine 45-jährige Patientin kommt während einer Grippe-Epidemie mit Erkältungssymptomen und Schwächegefühl in die Hausarztpraxis. Die klinische Untersuchung ergibt einen geröteten Rachen und geschwollene Lymphknoten u.a. am Hals. Die Patientin wird unter der Diagnose einer Influenza symptomatisch behandelt. Da die geschwollenen Lymphknoten auch noch sechs Wochen nach Abklingen der Erkältung bestehen, wird bei weiterführenden Untersuchungen eine chronisch lymphatische Leukämie festgestellt. Bezogen auf die Ursache der Lymphknotenschwellung dürfte sich der Hausarzt geirrt haben. Dieser Irrtum ist in der konkreten Situation allerdings nachvollziehbar.
Diagnoseirrtümer sind unvermeidbar und können zum Teil integrativer Bestandteil eines sorgfältigen diagnostischen Vorgehens sein.
Ad Diagnosefehler
Für den Diagnosefehler gelten die gleichen Anforderungen wie für den Behandlungsfehler. Er misst sich an dem Mass der Sorgfalt. Eine ex-post als falsch beurteilte Diagnose ist nicht per se ein Diagnosefehler, sondern nur die falsche, auf eine nicht sorgfältig durchgeführte Diagnostik beruhende Diagnosestellung entspricht einem Diagnosefehler. Diese falsche Diagnose wäre also bei korrekter und sorgfältiger Diagnostik so nicht gestellt worden. Auch hier muss durch einen entsprechend erfahrenen Fachgutachter geklärt werden, ob die Diagnostik nach dem aktuell gültigen Kenntnisstand bzw. gemäss den entsprechend gültigen Guidelines erfolgte, sofern solche bestehen. Auch im Zusammenhang mit diagnostischem Handeln muss das objektiv geschuldete Mass an Sorgfalt eingehalten werden.
Beispiel: Ein junger Patient kommt mit akuten rechtsseitigen Unterbauchbeschwerden in die Hausarztpraxis. Statt einer sorgfältigen klinischen Untersuchung, einer Laboranalyse und Einleitung einer bauchchirurgischen Abklärung hinsichtlich einer bestehenden Operationsindikation bekommt der Patient keine weiterführende Diagnostik und wird mit einer medikamentösen Analgesie in die Häuslichkeit entlassen. Am übernächsten Tag wird er tot zu Hause aufgefunden und die Obduktion zeigt als Todesursache eine von der rupturierten Appendix ausgehende 4-Quadrantenperitonitis.
Diagnosefehler sind per definitionem vermeidbar.
Meldepflicht
Die kantonalen Gesundheitsgesetze sehen gestützt auf Art. 253 StPO für aussergewöhnliche Todesfälle eine Meldepflicht vor. Nichtnatürliche und unklare Todesfälle müssen demnach unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. Bei Todesfällen im Rahmen einer medizinischen Behandlung bestehen hinsichtlich der Umsetzung der Meldepflicht aber häufig Unsicherheiten. Letztlich ist aber auch hier nur der natürliche Tod nicht meldepflichtig und natürlich ist ein es Todesfall, wenn er auf der Basis einer bekannten inneren Erkrankung erwartungsgemäss eingetreten ist und keine rechtlich relevanten äusseren Einflüsse vorgelegen haben. Damit sind tödliche Diagnosefehler und Behandlungsfehler und Fälle, bei denen das eine oder das andere möglich ist, meldepflichtig(4). Tödliche Behandlungsrisiken, Diagnoseirrtümer und Behandlungskomplikationen bedürfen einer individuellen Beurteilung. Tödliche Behandlungskomplikationen dürften in der Regel der Meldepflicht unterliegen, weil der Tod die Folge der Behandlung (als äusserer Einfluss) und nicht alleinig die Folge der Grunderkrankung ist. Das Gleiche gilt für einen tödlichen diagnostischen Irrtum. Beim Behandlungsrisiko steht definitionsgemäss der Zustand der Patient:innen im Vordergrund, sodass hier bei entsprechender Befundlage auch ein natürlicher Tod unter Behandlung angenommen werden kann, solange die Behandlung unter selbstkritischer Betrachtung sorgfältig erfolgt ist und der Tod Folge der inneren Erkrankung sein dürfte.
Hilfreich kann auch sein, wenn man sich bezüglich der Meldepflicht die einfache Frage stellt, ob der Patient oder die Patientin "trotz oder wegen" der Behandlung verstorben ist. Mit "trotz" würden Konstellationen erfasst, in denen die Behandlung das Ableben als Folge der inneren Erkrankung nicht mehr hat verhindern können (nicht meldepflichtig) und mit "wegen" würden Konstellationen erfasst, in denen der Tod ohne die Behandlung nicht oder nicht zu diesem Zeitpunkt eingetreten wäre (meldepflichtig).
Besonderheiten der Begutachtung
Bei der Beurteilung möglicher ärztlicher Sorgfaltspflichtverletzungen ist von besonderer Bedeutung, dass die Beurteilung immer aus der ex-ante Sicht erfolgen und weitestgehend unabhängig von ex-post bekannt gewordenen Erkenntnissen erfolgen muss. Es ist also nicht entscheidend, ob sich ein ärztliches Verhalten im Nachgang als richtig oder falsch herausgestellt hat, sondern ob das Verhalten zum Zeitpunkt des Handelns korrekt war. Dabei muss man sich als Gutachter oder Gutachterin loslösen können von dem, was als unerwünschtes Behandlungsresultat (Schaden oder Tod) zum Grund für die Begutachtung wurde. Diese Erkenntnisse liegen aus Sicht der behandelnden Ärzteschaft zum rechtsrelevanten Zeitpunkt noch in der Zukunft und konnten bei der Diagnosestellung bzw. Behandlungsplanung auch nicht berücksichtigt werden. Es gilt, einen sog. Rückschaufehler zu vermeiden.
Darüber hinaus ist ebenfalls wichtig, dass sich die rechtsmedizinische Gutachter:in vor allem auf die Befunderhebung und im Falle eines Todesfalles auf die Beurteilung der Todesursache und allfälliger Kausalzusammenhänge zur Todesursache beschränkt. Die konkreten Fragen rund um die Diagnostik und/oder Behandlung sollten durch in diesem Fachbereich tätige Fachgutachter:innen beantwortet werden. Bei der Auswahl solcher Fachgutachter:innen gilt es zu berücksichtigen, dass keine Befangenheitsgründe (positiv oder negativ) bestehen und dass sich die Person in einer vergleichbaren Anstellungssituation befindet. Selbstverständlich sollte diese Person auch über ausreichende Erfahrung im konkret zu beurteilenden Sachverhalt verfügen.
Fazit
Tödliche Diagnoseirrtümer, Behandlungskomplikationen, Diagnosefehler und Behandlungsfehler sind in der Schweiz meldepflichtig. In der überwiegenden Mehrheit der rechtsmedizinisch untersuchten Medizinalfälle kann kein Verdacht auf eine Sorgfaltspflichtverletzung erhärtet werden. In den meisten Fällen bestätigt die rechtsmedizinische Untersuchung ein vorgängig sorgfältiges Vorgehen der Ärzteschaft und stellt in aller Regel fest, dass sich eine Komplikation bzw. ein Diagnoseirrtum ereignet oder sich ein Behandlungsrisiko verwirklicht hat. Die Bestätigung einer ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzung (Diagnosefehler oder Behandlungsfehler) mit Todesfolge stellt im rechtsmedizinischen Arbeitsalltag ein eher seltenes Ereignis dar.
- Jackowski C. Skriptum Rechtsmedizin (15. Auflage), IRM Bern, 2023, S. 239 ff https://www.irm.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_vkhum/inst_remed/content/e40010/e136547/e136554/section136559/files208443/online-SkriptumRechtsmedizin2023-25.04.2023_ger.pdf
- Aebi-Müller R., Fellmann W., Gächter T. Rütsche B., Tag B. Arztrecht, Stämpfli Verlag, 2016, S. 33
- Kuhn M., Poledna T. Arztrecht in der Praxis (2. Auflage), Schulthess, 2007, S. 247
- Jackowski C., Kipfer G. in Niggli Herr Wiprächtiger. Basler Kommentar zu Art. 253 StPO, 24, S. 2257