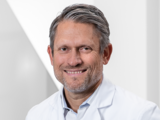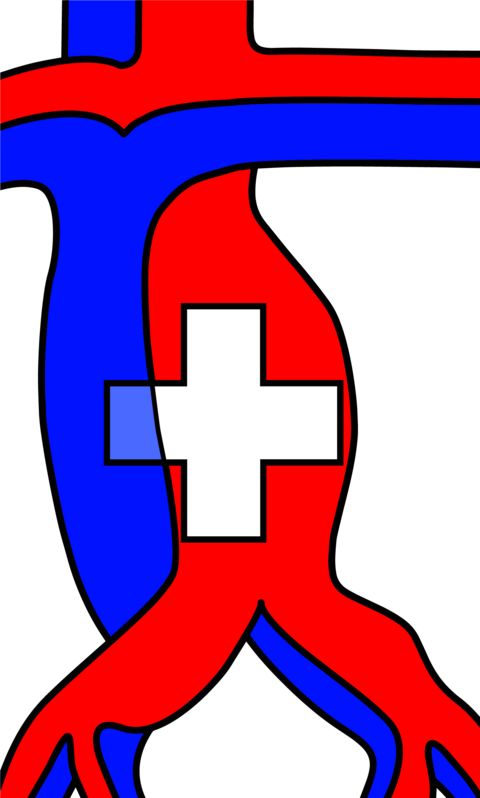Betrachtung der Forderung und der Begründungen
Aktuell fordern der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärzt:innen (VSAO) sowie einige kantonale Politiker das Limitieren der wöchentlichen Arbeitszeit auf 42 h, zuzüglich 4 h strukturierter Weiterbildung (42+4). Im Kanton Zürich sollte diese Umsetzung an die Leistungsaufträge für die Spitäler geknüpft werden, sprich ein Spital, welches dieses System nicht einführt, erhält keine Leistungsaufträge und kann somit nicht abrechnen.
Diverse Begründungen für diese Forderung werden genannt: Änderung der Prioritäten der Gen Z (Jahrgänge 1996-2012) zugunsten des «Life» und weniger des «Work», Umfragen bei Assistenzärzt:innen, welche eine Überlastung zeigen (wobei diese Klagen wegen des Nichteinhaltens der 50 h geäussert werden) und Student:innen, welche sich den Ausstieg aus dem Studium überlegen, da die Arbeitsbedingungen in den Spitälern so schlecht sind.
Interessanterweise mangelt es der Forderung an konkreten Umsetzungsvorschlägen. Einzig die Reduktion der administrativen Tätigkeiten wird genannt, was sehr generalisiert ist.
Grundsätzlich ist die Forderung der jungen Generation ja durchaus nachvollziehbar. Die Arbeit resp. der Beruf ist nicht mehr Berufung, und das private und soziale Leben nimmt einen wichtigeren Platz ein als dies bei uns, Generation X (Jahrgänge 1965-1980) oder Babyboomer (Jahrgänge 1946-1964), noch war. Der Beruf des Arztes/der Ärztin hat sich auch gesellschaftlich geändert, die kritische Haltung der Bevölkerung und der Politik, Misstrauen gegenüber der ärztlichen Leistung und die Auffassung, dass Ärzt:innen weitestgehend normale Dienstleister sind, nehmen zu und entsprechend ist es verständlich, dass die Bereitschaft, den ärztlichen Beruf als Berufung zu sehen und sich aufzuopfern, abnimmt. Richtig «Danke» sagt ja dann auch niemand. Ohne Zweifel kann bei 42+4 eine sehr gute Weiterbildung gewährleistet werden, sofern das äussere Umfeld und die Strukturen stimmen.
Leider versucht der VSAO einmal mehr, mit konfrontativen Forderungen eine Änderung zu erreichen, statt sich mit uns, den Chef- und Kaderärzt:innen, zusammen zu tun, um Lösungen zu finden. Es mag paradox klingen, aber den meisten Kaderärzt:innen liegt etwas an den Assistent:innen, wir wollen weiterbilden und geben uns Mühe (okay, mal mehr, mal weniger), die junge Generation zu kompetenten Ärzt:innen auszubilden. Der richtige Weg wäre der Aufbau einer Arbeitsgruppe, sei es über die Fachgesellschaften oder direkt über die Chefärzt:innen – interdisziplinär, objektiv, konstruktiv, ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Auch der VSAO sollte konsensorientiert mit uns zusammenarbeiten. Zudem, viele Assistenzärzt:innen sind loyal zu ihren Arbeitgeber:innen und zur Fachrichtung und könnten in einen Gewissenskonflikt geraten, zwischen Loyalität zu den Peers und der Loyalität zu ihren Chef:innen.
42+4: die Problematik
42+4 wäre ja eigentlich kein Problem, wäre da nicht unser sehr komplexes Gesundheitswesen. Hier finden sich diverse Player mit den entsprechenden Partikularinteressen und oftmals ohne Gesamtsicht. Das Gesundheitswesen ist kantonal organisiert, nicht national, entsprechend ist eine Gleichschaltung nicht möglich. Ein System, in dem jede Ärzt:in einfach Zugang zu den Patientendaten hat, wird zur Utopie. Die Tarife decken teilweise die Ausgaben nicht und bringen die Spitäler in defizitäre Lagen. Die Versicherer und die gesundheitspolitischen Organisationen (Gesundheitsdirektionen oder Bundesamt für Gesundheit) belasten die Leistungserbringer mit Unmengen von administrativen Zusatzaufgaben, und last but not least treten wir Ärzt:innen auch nicht geschlossen auf.
Schauen wir uns die Spitäler an, welche ja primär von einer Umsetzung von 42+4 betroffen wären: Wie aus den Jahresabschlüssen und der Tagespresse gut ersichtlich, steht es nicht gut um viele Spitäler. Sie sind finanziell in Schieflage geraten, sind auf Millionen von den Trägerschaften angewiesen, um weiterhin den Betrieb aufrechterhalten zu können. Wird denn schlecht gewirtschaftet? Vielleicht, und teilweise liegt da noch einiges an Verbesserung drin, aber nicht nur. Der ambulante Sektor ist de facto defizitär, wachst aber durch die (Zwangs)massnahme «ambulant vor stationär». Im stationären Bereich steht es etwas besser, aber nur wenn wirklich alles optimal organisiert ist, wenn die Effizienz maximal erreicht wird. Die Kosten sind gestiegen, z.B. die Löhne durch Fachpersonalmangel, Materialkosten oder Preise für Strom. Unter dem Strich geht es nicht mehr auf, wenn gleich viel reinkommt und mehr rausgeht, dann entsteht auch beim perfekten Spital ein Defizit. Die Forderung 42+4 führt zu einer Reduktion der Arbeitskraft der Assistenzärzt:innen, und dies muss kompensiert werden, was Kosten verursacht. Und wer kann diese tragen? Selbstverständlich können und sollen gewisse nicht-ärztliche (administrative) Tätigkeiten an andere Berufsgruppen verlagert werden, aber auch diese müssen bezahlt werden. Leider ist die Zitrone ausgequetscht, und wir brauchen eine gesamtheitliche Problemlösung in unserem Gesundheitswesen, nicht nur – aber auch – um 42+4 finanzieren zu können.
Die Administration
Wir alle leiden unter der administrativen Belastung, nicht nur die Assistenzärzt:innen, auch die Kaderärzt:innen und natürlich wir Chef:innen (kein Jammern hier, wir haben uns den Job ja ausgesucht). Ich versuche seit Jahren, die administrative Belastung in der Klinik zu reduzieren, und wenn wir etwas gefunden haben, dann wird uns etwas Neues aufdoktriniert. Viele administrativen Aufgaben werden nicht von den Klinikleitern oder den Spitaldirektionen gefordert, sondern von den Gesundheitsdirektionen, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), den Versicherern, Organen wie der interkantonalen Vereinbarung für die hochspezialisierte Medizin (IVHSM). Ja, wir dokumentieren uns halb zu Tode, damit unsere Codierer ihre Arbeit auch ordentlich tun können, damit die Versicherer nicht dauernd nachfragen, damit bei Haftpflichtfällen wir medico-legal geschützt sind. Ja, wir müssen unsere Leistung erfassen, weil nur derjenige das machen kann, der Leistung erbringt. Ja, wir müssen Register und Datenbanken füllen, weil das BAG, der Kanton oder die IVHSM uns dazu zwingen. Ja, wir müssen allen Informationen nachrennen, weil das elektronische Patientendossier ein Rohrkrepierer ist und überhaupt nicht funktioniert.
Die Reduktion der Administration, unabhängig auf welcher Stufe, ist oftmals anspruchsvoll und in einem einzelnen Spital nicht ausgedehnt möglich. Klar, man kann hin- und her schieben. Die Assistenzärzt:innen sollen doch keine Briefe mehr schreiben, dann wäre 42+4 mir nichts dir nichts umgesetzt. Das können doch die Oberärzt:innen machen, wobei diese in gewissen Kantonen gleiche Anstellungsbedingungen wie die Assistenzärzt:innen haben und somit auch auf 42+4 geschaltet werden würden. Oder Leitenden Ärzt:innen, da hätten wir keine Arbeitszeitprobleme – mal schauen, wie lange es geht, bis diese beiden Hierarchiestufen dann auf der Matte stehen. Nein, es braucht hier grundlegende Massnahmen. Leider dauert so etwas in unserem Land sehr lang. Zugriff zu allen Daten einer Patient:in, unabhängig davon, ob es Informationen im Spital oder bei den niedergelassenen Ärzt:innen sind, analog zum dänischen System, wäre eine riesige Entlastung. Dann müssten wir nicht bei jeder Patient:in alles von Neuem aufschreiben. Dazu muss das Gesundheitssystem aber schweizweit so strukturiert werden, dass der Zugriff zu den Patient:innendaten und die Klinik- und Praxisinformationssysteme standardisiert und auch kantonsübergreifend möglich wird. Realistisch? Wahrscheinlich nicht in der nahen Zukunft. Der Versuch wurde mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) gemacht, und da wurden grobe Fehler begangen: Nur die Spitäler wurden verpflichtet, die Voraussetzungen für das EPD zu schaffen, allen Praxen blieb es offen, ob sie dies machen oder nicht, die Herausgabe des EPD wurde dezentral an Firmen delegiert und last but not least blieb es für die Patient:in nicht nur freiwillig, sondern auch noch umständlich, sodass heute nicht einmal 1% der Bevölkerung ein solches Dossier hat.
Dann wären da noch die Versicherer, welche uns mit dauernden Anfragen und Zeugnissen belasten. Müssen wir das machen? Ja, sonst kommt kein Geld. Macht es Sinn? Nein. Gibt es eine Lösung? Ja, vielleicht das System staatliche Einheitskasse, analog zu den skandinavischen Ländern und Grossbritannien. Realistisch? Vielleicht, wir haben vor vielen Jahren schon einmal darüber abgestimmt, damals dies aber verworfen. Heute würde eine Einheitskasse möglicherweise durchkommen. Nur muss dann diese Behörde effizient aufgestellt werden und nicht zu einem administrativen Moloch verkommen. Diese Befürchtung ist das Hauptargument der Gegner und sicher berechtigt, gerade wenn man sieht, was beim EPD abgelaufen ist.
Die Reduktion der Präsenzzeit der Assistenzärzt:innen (und auch der Kaderärzt:innen) führt auch zu einer administrativen Mehrbelastung, denn die Reduktion bedingt zwangsmässig Schichtsysteme. Diese ihrerseits sind vergesellschaftet mit mehr Schnittstellen, mehr (schriftlichen) Übergaberapporten, mehr Informationsverlust und entsprechend auch Doppelspurigkeiten, nicht zu sprechen von einer potenziellen Patientengefährdung.
Zwei weitere Aspekte
Betrachtet man das +4, dann reden wir von strukturierter Weiterbildung. Das SIWF (vom VSAO miterarbeitet) definiert eine strukturierte Weiterbildung als formell eingeplant, angekündigt und dokumentiert. Wie wird man aber den verschiedenen Fachgebieten gerecht? Zukünftige Internist:innen verstehen darunter Vorträge, Fallbesprechungen, Journal Clubs, Trouble Shootings, Morbidity und Mortality-Konferenzen und vielleicht spezifische Einzeltutoriate. Und die interventionell und operativ tätigen Assistent:innen? Ist eine schrittweise assistierte Cholezystektomie auch eine strukturierte Weiterbildung oder die durch die Instruktor:in begleitete Koronarangiographie? Ich denke schon, denn das sind diejenigen Weiterbildungsteile, welche diese Gruppe von Assistent:innen interessiert. Instruktionsoperationen gehen aber, insbesondere wenn sie strukturiert begleitet werden und eventuell auch nachbesprochen werden, länger, als wenn die Instruktor:in selber operiert. In der heutigen Zeit sind wir auf effiziente Prozesse angewiesen, insbesondere in den teuren Abteilungen wie einem Operationssaal. Nun sollen wir die Arbeitszeit verringern und 4 h strukturierte Weiterbildung gemäss SIWF anbieten, dies natürlich bei gleichem Lohn resp. fehlender externer finanzieller Unterstützung. Um es kostenneutral zu gestalten, könnten die Instruktionsassistenzen reduziert werden, dann sparen wir diese Zeit und Ausgaben wieder ein. Das kann ja nicht die Lösung sein, und es braucht die Diskussion, was denn wirklich in die Weiterbildung gehört.
Ein weiterer Aspekt ist das Selbstbestimmungsrecht der Assistent:innen. Wir sprechen von einer heterogenen Gruppe von Akademiker:innen, welche nach Bestehen eines strengen Numerus clausus-Tests und fordernden sechs Jahren Studium in ihrer ersten ärztlichen Funktion von dieser Diskussion betroffen sind. Der VSAO vertritt bei weitem nicht alle, und gerade viele der operativen Assistent:innen arbeiten gerne, haben Spass am Beruf und möchten nicht in eine gesetzliche Zwangsjacke gesteckt werden. Warum kann man es nicht offenlassen, und jeder entscheidet, ob 42+4 oder 46+4. Wir sollten die Wünsche eines Einzelnen respektieren, das Erreichen des Facharzttitels ist bei den operativen Disziplinen zu Recht an einen Operationskatalog gebunden, bei den nicht-operativen Fächern primär an die Weiterbildungszeit. Trotz der generellen Einführung der Entrustable Professional Activities (EPA) werden wir wohl noch weitere fünf bis zehn Jahre lang Operationskataloge fordern müssen, um sicherzustellen, dass eine operativ tätige Mediziner:in auch die entsprechende Erfahrung beim Erreichen des Facharzttitels aufweist. Natürlich verkompliziert eine solche flexible Lösung die Dienstplanung, und ein Missbrauch ist auch möglich, indem die 46+4 besser weitergebildet werden als die 42+4. Aber bereits heute wird individuell unterschiedlich weitergebildet, und Fleiss, Motivation, gute Arbeit führen nicht nur in der Medizin zu einer steileren Karriere.
Last but not least: die Patient:innen
Der primäre Zweck der Spitäler ist die Behandlung der Patient:innen, und nicht die Weiterbildung. Das ist eine zusätzliche Verpflichtung, im Mittelpunkt muss aber immer die Patient:in stehen. Bei einer Operation muss die Instruktor:in übernehmen, wenn Weiterzubildende die Patient:in gefährden, ich denke da sind wir uns alle einig. Viele Tätigkeiten, gerade die administrativen Teile, machen wir, um ein optimales Management der Patient:innen und die maximale Sicherheit generieren zu können. Werden die Spitäler weiter unter Druck gesetzt, dann wird einigen nichts anderes übrigleiben, als noch mehr zu sparen. Und das wird nach Möglichkeit nicht beim Patient:innenmanagement und der Sicherheit geschehen, sondern in anderen Bereichen, gute Möglichkeiten sind da die ärztlichen Löhne oder Weiterbildungsbudgets. Zudem können Strukturänderungen dazu führen, dass ein Grossteil der klinischen Arbeit auf Fachspezialist:innen verteilt wird, und ein entsprechender Abbau der Weiterbildungsstellen erfolgt. Fachspezialist:innen arbeiten auch «nur» 42 h, aber sie bleiben in der Regel jahrelang und bieten Kontinuität, und sie pochen nicht auf eine fixe Stundenzahl strukturierte Weiterbildung.
Wiederholt wird Dänemark als die Idealvorstellung genannt. Durch persönliche Beziehungen kenne ich das System gut. Die Ärzt:innen arbeiten deutlich weniger als in der Schweiz, haben mehr Freizeit und bekanntermassen sind die Dän:innen ja das glücklichste Volk auf der Erde. Da gibt es aber einige «Abers»: Das Lohnniveau in Dänemark ist deutlich tiefer als in der Schweiz. Das mag die Dän:innen nicht stören, diese sind aber auch weniger reiselustig als wir Schweizer:innen und haben nicht teure Hobbys wie Skifahren oder Reisen. Weniger Arbeit führt fast immer zu weniger Lohn, einmal mehr ist dies nicht nur in der Medizin ein Fakt.
Die dänische Patient:in ist genügsam und sich gewöhnt, auf eine Arztkonsultation tagelang und auf eine elektive Operation monatelang zu warten. Und in der Schweiz? Da organisieren wir unseren Patient:innen alles im «nur gestern ist gut genug»-Modus, auch weil wir den Konkurrenzdruck des nächstgelegenen Spitales spüren. Was würde Herr und Frau Schweizer sagen, wenn ich den Operationstermin für die symptomatische Cholezystolithiasis in sieben Monaten festlege? Wir sind Schweizer:innen und keine Dän:innen, und man darf den Apfel nicht mit der Birne vergleichen. Einiges, wie bereits erwähnt, sollten wir unbedingt übernehmen, aber man macht nicht so einfach aus einer Schweizer:in eine Dän:in.
Abschliessende Bemerkungen
Man mag es mir nicht glauben, aber ich kann mir eine Spitalwelt mit 42+4 oder sogar 36+8 sehr gut vorstellen. Ich möchte, dass meine Assistent:innen, aber auch meine Kaderärzt:innen, nicht in der Administration ersaufen, ich möchte, dass wir strukturiert und effizient weiterbilden, unsere Ärzt:innen zu den besten der Welt gehören und meine zukünftige Operateur:in ihren Job mit grossem Wissen und hoher technischer Kompetenz, vor allem aber mit Freude, macht. Leider kann man in einem komplexen System, in welchem alles irgendwie zusammenhängt, nicht einfach an einem kleinen Rädchen drehen und meinen, dann sei alles gut. Schnellschüsse mögen einem Verband und einer einzelnen Politiker:in nützen, aber nicht den Betroffenen. Es braucht eine umfassende Diskussion unter Miteinbezug der erwähnten Definition der Weiterbildung, der Finanzierung, der Entscheidungsfreiheit der Assistent:innen. Möglichkeiten der Reduktion des administrativen Aufwands unter Berücksichtigung der Patient:innensicherheit müssen hier einfliessen. Die Weiterbildung wird nicht besser, wenn die Weiterbildner:innen zu etwas gezwungen werden. Das führt höchstens dazu, dass man sich weniger Mühe gibt, oder noch schlimmer, uns aus dem System verabschieden und in die Praxis gehen. Für mich, und viele meiner Kolleg:innen, sind der Kontakt zur nächsten Generation und das Weiterbilden mit ein Grund, warum wir da sind, wo wir sind. Wir müssen zueinander Sorge tragen, nicht nur die Assistent:innen sind belastet, die Kader sind es auch.
Acknowledgement
Der Autor dankt Prof. Markus Furrer, ehem. Leiter Departement Chirurgie, Kantonsspital Graubünden, für die kritische und konstruktive Durchsicht des Manuskripts.